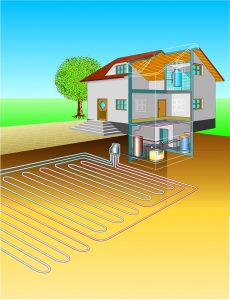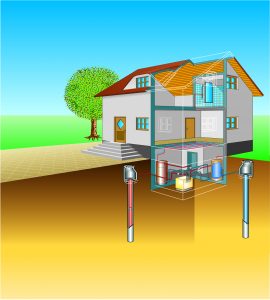Was die Aufgabe einer Dichtung ist, weiß jedes Kind. Dass es aber spezielle industrielle Dichtungen gibt, ist vielen Menschen neu – woher soll man das auch wissen! Dabei sind industrielle Dichtungen mittlerweile weder aus der Technik noch aus der Industrie wegzudenken.
Dass industrielle Dichtungen in unserem täglichen Leben eine enorme Rolle spielen, zeigt das breit gefächerte Aufgabengebiet: Man braucht sie am Arbeitsplatz, im Haushalt, in Maschinen oder Fahrzeugen. Überall wo Dichtungen zum Einsatz kommen, übernehmen sie die Rolle eines wichtigen Bauelements oder sind unerlässlicher Teil einer ganzen Konstruktion. Sie haben dabei stets die Aufgabe, ungewollte Stoffübergänge von einem Raum in einen anderen zu verhindern oder diesen zu begrenzen.
Bei der Unterscheidung verschiedener industrieller Dichtungen gilt es zunächst, zwischen Berührungsdichtungen und berührungslosen Dichtungen zu differenzieren. Danach wird nach der Relativbewegung der gegeneinander abzudichtenden Teile in statische (keine Bewegung), translatorische (geradlinige Bewegung) und rotatorische (drehende Bewegung) unterteilt. Zu den statischen Dichtungen zählen Profil-, Muffen-, Walz-, Wellen-, Einschleif- und Flachdichtungen. Bei Stopfbuchse, Kolbenring, Faltenbalg, Hydraulikdichtung und Bürstendichtung bewegen sich die Dichtelemente hingegen relativ zueinander, so werden diese als dynamische Dichtungen bezeichnet. Ist die Relativbewegung der Dichtelemente rotatorischer Art, so spricht man von rotatorischen Dichtungen. Hierzu zählen die Radialwellendichtung für Niederdruckanwendungen, die Axialwellendichtung für untergeordnete Dichtaufgaben oder die Gleitringdichtung für hohen Druck bis 300 bar. Berührungslose Dichtungen verwendet man bei dynamischen Dichtungen wie etwa bei Druck- und Drossel-, Massenkraft- und Viskositätsdichtungen. Die bekanntesten Dichtungen dieser Gruppe sind die Schleuderscheibe und der Spritzring. Je nach Einsatzgebiet, Berührungsintensität und Relativbewegung finden also die unterschiedlichsten Dichtungen ihre Anwendung.
All dies gehört nicht zum Alltagswissen, ist aber in aller Ausfürhlichkeit auf der Wikipedia nachzulesen.
Wer dabei noch genauer ins Detail gehen möchte, vor allem ausführliche Produktakataloge sehen möchte, der kann alles zum Thema Dichtungen beim Experten nachlesen. Auf dieser Seite finden so richtige Fans auch alle Messetermine zum Thema Dichtungen, Dichtungstechnik und Wassertechnik. Ich finde vor allem die „Pumps and Values“ in Dortmund unglaublich spannend. Die Termine dazu gibt es unter http://www.billi-seals.de/de/unternehmen/messetermine/.